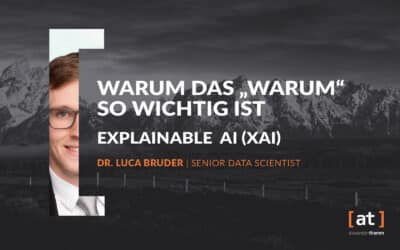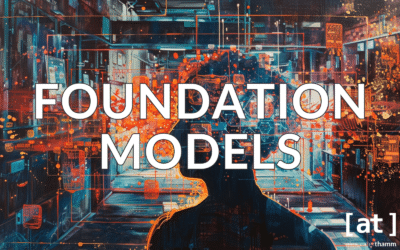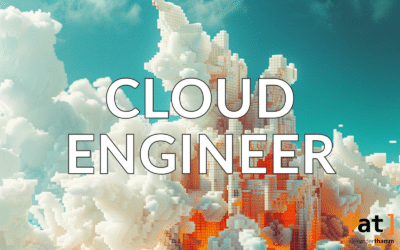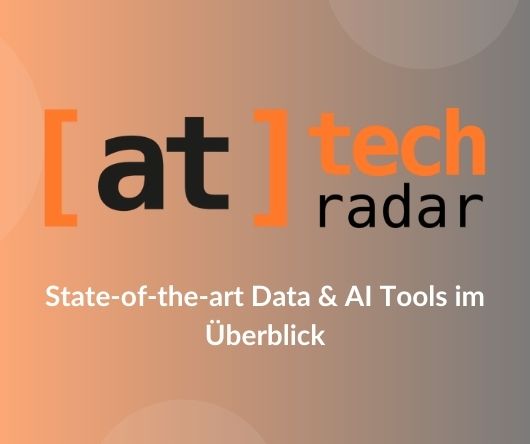data.blog – Wissenswertes zu Data Science und Künstlicher Intelligenz
LLM Explainability: Warum das „Warum“ so wichtig ist
„Erklärbare KI“ (XAI) ist für das Verständnis der Entscheidungslogik hochkomplexer KI-Modelle wie LLMs von entscheidender Bedeutung. Angenommen, Sie haben einen Kredit bei einer Bank beantragt. Im Gespräch mit dem Bankvertreter wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihr...
Generative Künstliche Intelligenz: Das Ende einer Illusion
Noch sind die juristischen Auseinandersetzungen bezüglich der Urheberrechte beim Training von Bild- oder Kunstgenerierenden Algorithmen nicht entschieden. Doch unabhängig vom Ausgang der Verfahren, die Entwicklung wird die Stellung der Künstler hinterfragen und neu...
Foundation Models: Eine Einführung
Generative KI ist ein beliebter Begriff in der Geschäftswelt, und die zugrundeliegende Technologie, Foundation Models (kurz FMs), gewinnt aufgrund ihrer breiten Anwendung und Akzeptanz an Zugkraft. Die Technologie ist für Unternehmen auf...
Gewusst wie: Cloud Engineer im Jobprofil
Der stetige Übergang moderner Unternehmen zum Cloud Computing und zur Datenspeicherung schafft den Bedarf an einem Cloud Engineer. Cloud-Ingenieure sind IT-Mitarbeiter, die für alle technischen Aufgaben im Zusammenhang mit Cloud Computing...
Datensicherheit: Kompakt erklärt
Alles, was wertvoll ist, muss geschützt werden, und dazu gehören auch Daten. Die Bedeutung von Daten in der heutigen Welt macht sie zu einem schützenswerten Gut, was Datensicherheit als technologisches Konzept erforderlich macht. Dieser...
Die 14 wichtigsten großen Sprachmodelle: Ein umfassender Überblick
Große Sprachmodelle sind eine entscheidende Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz und verändern die Art und Weise, wie wir mit Technologie umgehen. Diese hochentwickelten Modelle, die auf der Grundlage umfangreicher Datensätze...
European AI Act
Technologische und rechtliche Beratung